Der Europäische Rat und das deutsch-französische Verhältnis
Energiepolitik - Einigung unter großen Mühen
Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU haben sich am Freitag, 21. Oktober 2022, im Europäischen Rat in Brüssel auf einen Kompromiss geeinigt. Der Gipfel stand ganz im Zeichen der Energiepolitik. In der umstrittenen Frage der Gaspreisbegrenzung soll es einen sogenannten „vorübergehenden dynamischen Preiskorridor für Erdgastransaktionen“ geben, der Preisspitzen kappt und eine Obergrenze für Gas vorsieht, das zur Stromerzeugung verwendet wird. Diesen zäh errungenen Kompromiss sollen nun Kommission und EU-Minister beschlussreif ausarbeiten. Ob damit der Streit um die richtige Energiepolitik in Krisenzeiten vom Tisch ist, bleibt abzuwarten.
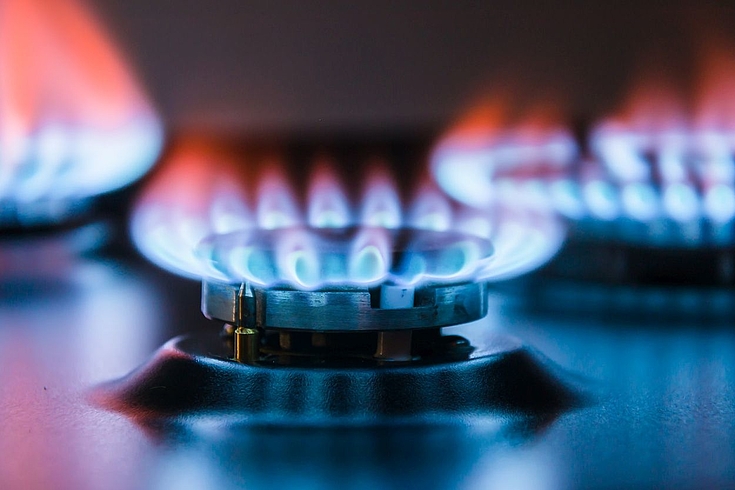
Der Energie-Gipfel vom 20. und 21. Oktober 2022 führte nach langen Verhandlungen auf einen Fahrplan, um auf die gestiegenen Gas- und Strompreise zu reagieren.
Valerii Vtoryhin; HSS; istock
Pro und Contra Gaspreisdeckel
Die Vorgeschichte des Spitzentreffens ließ keine allzu großen Erwartungen auf klare Beschlüsse zu einer kohärenten europäischen Energiepolitik aufkommen. Zu weit klafften die Positionen Pro oder Contra beim Gaspreisdeckel auseinander: Während eine Mehrheit der Mitgliedstaaten darunter Frankreich, Italien und viele kleinere Staaten sich für die Preisobergrenze aussprachen, wandte sich eine Minderheit darunter Deutschland, die Niederlande und Ungarn vehement dagegen. So argumentierte man auf deutscher Seite, dass in Anbetracht einer begrenzten Marktmenge von Flüssiggas der Preisdeckel für eine Umleitung des Gases zum zahlungsbereiten Asien sorgen würde, dagegen betonte Frankreich die beherrschende Marktmacht der EU, die genau dies verhindere.
Überlagert wurde diese inhaltliche Auseinandersetzung über den richtigen Kurs zur Bekämpfung der drastisch gestiegenen Gaspreise, durch die Sorge vor deutschen Alleingängen, die von vielen EU-Ländern geteilt wird. Im Mittelpunkt der Kritik an Deutschland steht seit längerem das 200 Milliardenschwere Entlastungspaket der Bundesregierung für Bevölkerung und Wirtschaft, das den Wettbewerb innerhalb der EU gerade gegenüber den wirtschaftsschwächeren Staaten verzerre, und „protektionistische Züge“ aufweise, wie der lettische Premierminister Kariņš folgerte. Im Kern widerspricht dieses nationale Programm, so der Vorwurf, einer Politik europäischer Solidarität, die von Deutschland als Führungsmacht erwartet wird. Nimmt man hierzu noch den Widerstand der Bundesregierung gegen den Gaspreisdeckel, so wird das Bild eines auf sich selbst bezogenen, sich europäischer Verantwortung entziehenden Deutschlands komplettiert. Dagegen steuern konnte Bundeskanzler Scholz auch nicht mit seinem Votum für gemeinsame Einkäufe von Gas auf europäischer Ebene.
Der deutsch-französische Motor stottert?
Schwer wiegt in dieser Situation, dass Frankreich an der Spitze der Deutschland-Kritiker steht und der deutsch-französische Motor, bisher Garant für die Führung und einheitliche Linie der EU nach außen, damit ins Stocken gerät. Äußeres Zeichen für die angespannte Stimmungslage zwischen beiden Ländern war die kurzfristige Verschiebung der deutsch-französischen Kabinettsitzung am Mittwoch (19. Oktober 2022) vor dem Gipfel, in der sie sich gemeinsam zu den entscheidenden Fragen der Energie- und Wirtschaftspolitik positionieren wollten. Daher war es auch nicht mehr verwunderlich, als Macron seinen deutschen Partner am Rande der Sitzungen öffentlich vorwarf, sich in der EU mit seiner Haltung zu isolieren.
Ein weitaus herberer Schlag als öffentliche Kritik am Partner könnte für die deutsch-französischen Beziehungen Macrons Opposition gegen die von Spanien vorangetriebene Midcat-Gaspipeline über die Pyrenäen sein; Berlin erhoffte sich davon die Lieferung von Flüssigerdgas aus den LNG-Terminals in Portugal und Spanien nach Mitteleuropa. Als Ersatzprojekt für Nord Stream 2 ist sie seit letzter Woche gescheitert. Unmittelbar vor dem Start des Gipfels hatte Macron nach einem Treffen mit Spaniens Premier Sanchez und Portugals Antonio Costa das Aus für Midcat verkündet, an dessen Stelle nun eine neue Wasserstoff-Leitung zwischen Barcelona und Marseille treten soll. Auch dies wird ausreichend Gesprächsstoff für beide Staaten liefern. Eine Möglichkeit zu einem konstruktiven Miteinander zu finden, bestand in einem bilateralen Treffen zwischen dem französischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler am 26. Oktober 2022.
Bilanz des Energiegipfels
Die EU hat sich auf einen Fahrplan geeinigt, aber keine Beschlüsse gefasst: Eine „dynamische Preisgrenze“ für in der EU gehandeltes Gas soll es geben, ebenso einen gemeinsamen Einkauf von mindestens 15 Prozent des Gasspeichervolumens in der EU und einen Solidaritätsmechanismus für EU-Mitgliedstaaten, um in Notfällen gemeinsam Gas zu nutzen. Damit folgt der Europäische Rat im Wesentlichen den vorgegebenen Plänen der Kommission. Mehr aber auch nicht.
Weiterhin stehen die Differenzen zwischen den EU-Mitgliedsländern im Raum, allen voran Frankreichs und Deutschlands. Zuletzt hatte das Ansehen der Bundesregierung in der EU stark gelitten – immer wieder war jüngst in Brüsseler Kreisen zu hören, dass Deutschland rücksichtlos auf Kosten anderer Länder seine Wirtschaftsinteressen verfolge. Auch wenn Bundeskanzler Scholz nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass andere Länder es genauso machten. Der Eindruck bleibt: Deutschland tut sich mit seiner Ampel-Koalition schwer, in einer der tiefsten Krisen seit dem 2. Weltkrieg zusammen mit Frankreich seiner Führungsverantwortung in der EU gerecht zu werden und europäische Lösungen voranzutreiben. Letztlich gilt es Vertrauen in der EU wiederherzustellen, wie es der belgische Premierminister De Croo anmahnte. Wie das gelingen kann, steht in der Schlusserklärung des Gipfels. Hier heißt es, die EU solle sowohl nationale als auch EU-Instrumente zur Unterstützung ihrer Volkswirtschaften einsetzen und „gegebenenfalls“ gemeinsame europäische Lösungen finden. Was das konkret heißen soll, bleibt offen. Dazu braucht es allerdings die Führung des deutsch-französischen Tandems.
Kontakt

Leiter
