Zu Ende gedacht?
Die Erbschaft als ökonomischer Irrtum
In Deutschland entbrennt immer aufs Neue eine Diskussion über die Erbschaftsteuer. Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Welche Erben sollten besteuert werden? Welche nicht? Und wenn ja, wie hoch sollten sie besteuert werden? Fakt ist: Die Erbschaftsteuer besteuert – aus wirtschaftlicher Sicht – den Erblasser, nicht den Erben. (Symbolbild)
©fizkes/Adobe Stock
„In Deutschland ist mehr Vermögen durch Erbschaften entstanden als durch die eigene Hände Arbeit – Tendenz steigend“, schreibt Marcel Fratzscher, Professor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-Universität, auf seinem X-Account.
In seinen Einlassungen zur Erbschaftssteuer verweist Ökonom Fratzscher auf das „leistungslose Einkommen“ und darauf, dass damit die Chancengleichheit untergraben wird. Auf den ersten Blick scheint das einleuchtend: Wer erbt, der hat nichts dafür getan – also hat er auch keinen Anspruch darauf. Gerechtigkeit wieder hergestellt, Fall erledigt.
Irrtum! Denn an dieser Stelle beginnt erst das ökonomische Problem.
„Leistungslos“ ist kein ökonomischer, sondern ein moralischer Begriff. Märkte bewerten keine Tugenden, sie verarbeiten Knappheit. Sie entlohnen Wertschöpfung – unabhängig davon, ob diese heute oder über Generationen erbracht wurde. Eigentum entsteht nicht nur durch Arbeit, sondern durch Sparen, Investieren und Risikoübernahme.
Besteuert wird nicht der Tod
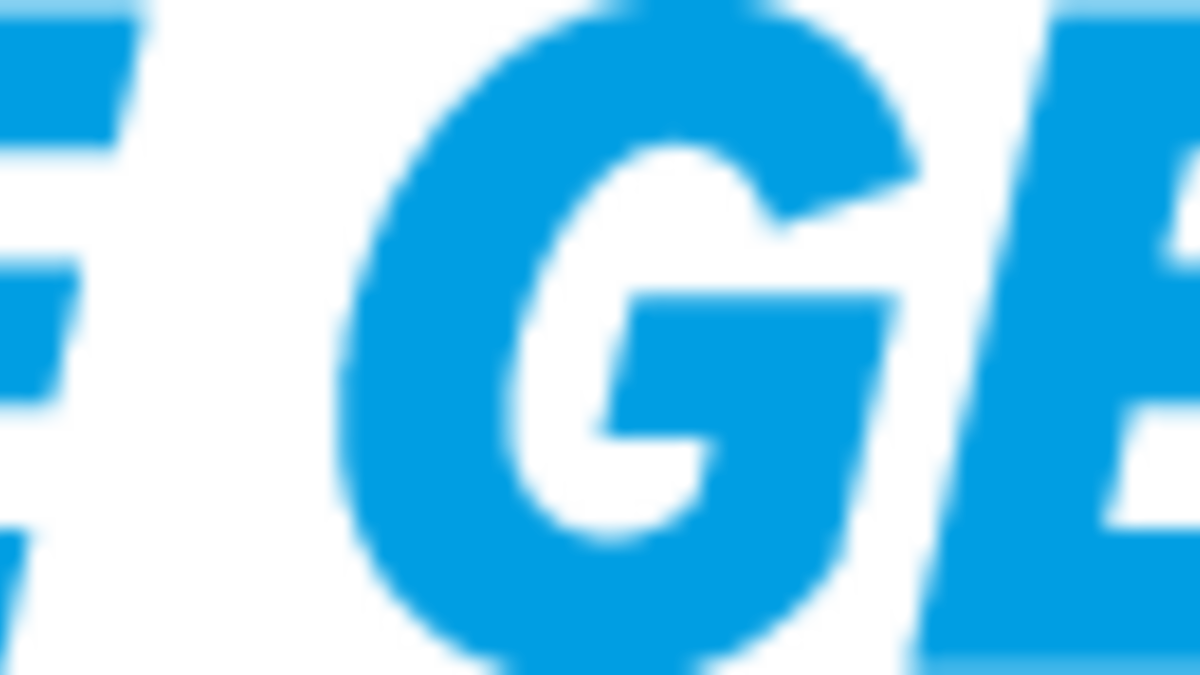
Ein aktuelles Zitat aus prominentem Mund genau betrachten und auf seinen ökonomischen Gehalt prüfen: Das wollen wir mit unserer Reihe „Zu Ende gedacht?“ Wir analysieren regelmäßig, welche Botschaften Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft senden – und welche Schlussfolgerungen sich daraus ziehen lassen.
Die entscheidende Frage lautet: Welche Anreize würde eine Erbschaftsteuer für die Erben setzen?
Zum Hintergrund: Besteuert wird nicht der Tod, sondern das Verhalten vor dem Ableben.
In einer sozialen Marktwirtschaft ist Eigentum ein Ordnungsprinzip. Es schafft Planungssicherheit und verbindet Gegenwart mit Zukunft. Wer im Vorhinein weiß, dass Vermögen am Lebensende abgeschöpft wird, spart weniger, investiert anders oder konsumiert früher. Langfristiges Wirtschaften etwa und die Weitergabe von Familienunternehmen an die nächste Generation verlieren an Attraktivität. Damit wird die Erbschaftsteuer ökonomische zu einer Steuer auf Kapitalbildung – nicht auf Ungleichheit.
Fratzschers Argument der Chancengleichheit verwechselt zwei Ebenen: Chancengleichheit bedeutet gleiche Startbedingungen, nicht gleiche Ergebnisse. Der Staat kann Bildung, Infrastruktur und Rechtsstaatlichkeit bereitstellen. Er kann aber nicht verhindern, dass Eltern ihren Kindern Vorteile verschaffen – wie Zeit, Netzwerke, Wertevermittlung oder Zukunftsvorsorge mithilfe von Vermögensbildung. Die Vorstellung, eine Erbschaftsteuer könnte echte Chancengleichheit herstellen, wird überschätzt und verfehlt gesellschaftliche Realität.
Eigentum verliert seine Verlässlichkeit
Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Erbschaften sind kein Marktversagen, sondern Ergebnis funktionierender Eigentumsrechte. Wer sie als „leistungslos“ delegitimiert, stellt infrage, ob Eigentum über den Tod hinaus gelten darf. Doch Eigentum, das politisch jederzeit relativiert werden kann, verliert seine Verlässlichkeit. Ohne verlässliche Eigentumsrechte gibt es weniger Investitionen, weniger Wachstum – und am Ende auch weniger Umverteilung.
Zu Ende gedacht heißt das: Die Erbschaftsteuer mag für den, der das Thema nicht gesamthaft verstanden hat, moralisch befriedigend wirken. Aber ökonomisch gesehen, besteuert sie nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft, auch nicht den Erben, sondern den Erblasser und nicht die Ungerechtigkeit, sondern die Vorsorge.
Kontakt

Leiterin

